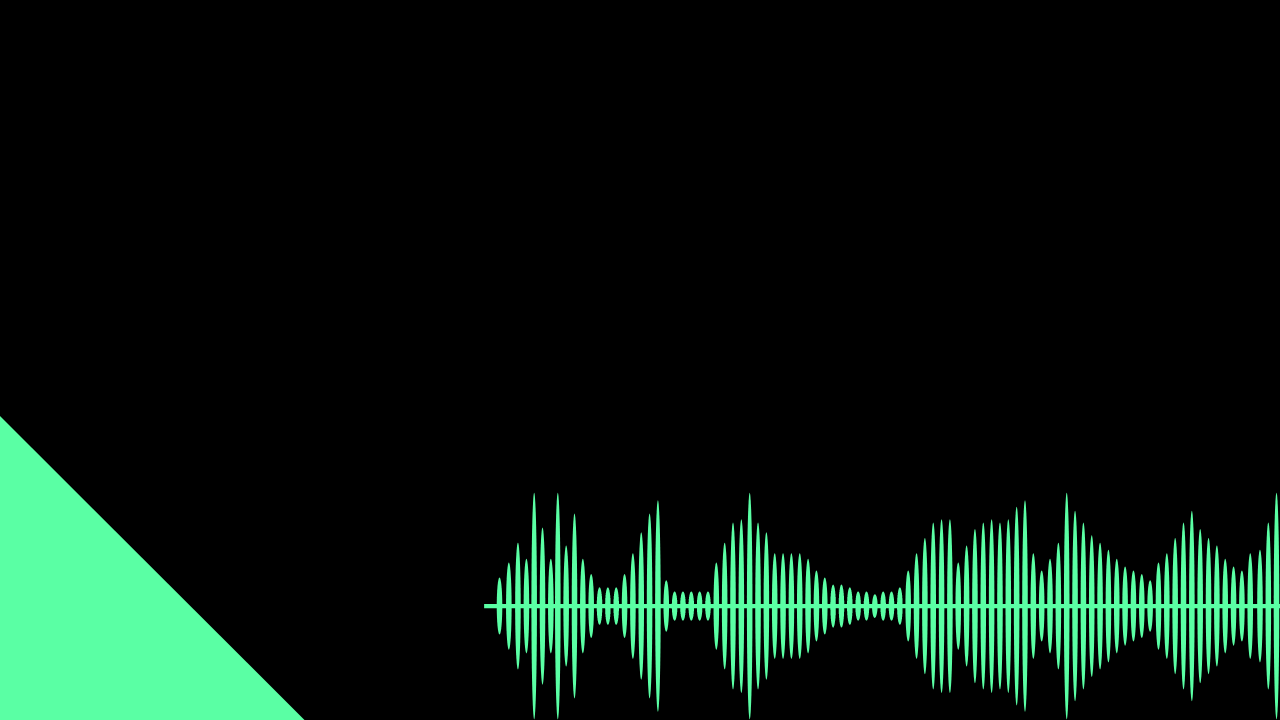
Goldelse - Geldgeschichten - der Firmenpodcast der Berliner Volksbank
Geldgeschichten aus der Hauptstadt
Transkript
Innovation ist leicht gesagt und schwer gemacht.
Vor allem im Mittelstand, wo Termine drängen, Personal knapp ist und das Kerngeschäft läuft.
Die Frage ist, muss wirklich jedes Unternehmen das nächste große Ding erfinden?
Oder reicht es manchmal einfach, das Richtige richtig gut zu machen?
Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Bastian Haleker.
Er ist Professor für Deep-Tech Entrepreneurship an der XU Exponential University in Potsdam, kommt selbst aus einer Mittelstandsfamilie, kennt die Start-up-Szene aus eigener Erfahrung und bringt seit Jahren Wissenschaft, Technologie und Praxis zusammen.
Wir reden über Friedhofsoftware, Pop-up-Unis, künstliche Intelligenz und darüber, warum Innovation oft beim Problem beginnt, nicht bei der Lösung.
Willkommen bei GoldElse, dem Podcast der Berliner Volksbank.
Los geht's. Ich bin ja zum einen in der Wissenschaft und Akademie unterwegs, auf der anderen Seite bin ich sehr stark in der Industrie, kaufmännischer Background, und dann auf der anderen Seite Technologie und Start-up.
Da ist im Moment der Sweet-Spot genau in der Mitte, weil Wissenschaft ist langweilig, muss als Wachgeküsst werden, Start-up ist schon immer hot und sexy, und der Mittelstand ist eher der Verträumte.
Da, wo tatsächlich viele spannende Probleme existieren, die müssen wir zusammenbringen.
Empfindest du den Mittelstand so verträumt?
Ich würde nicht sagen verträumt im Sinne von, dass er vor sich hinträumt und nichts tut, sondern kommt er mir sehr mit sich selbst beschäftigt vor, so ein bisschen abgehangen gefühlt.
Er kriegt halt viele Dinge, die heute passieren, mit hoher Dynamik eben nicht mehr mit.
Und deshalb bin ich immer der Meinung, dieses Wachrütteln an bestimmten Enden tut halt Not.
Wobei, die Welt ändert sich rasant, bitte wach auf, so auf der Ebene.
Okay.
Ich glaub, ich weiß genau, was du meinst.
Obwohl man, glaub ich, sagen muss, es gibt manche, die total vorneweg rennen, immer wieder kennengelernt, und manche, die sehr verhaftet sind.
Wir sprechen von Stadt-Land-Gefälle immer mal wieder.
Wir hatten uns gerade schon kurz darüber unterhalten, wir haben beide einen Background in der Ostprygnitz, sind aber beide auch mittlerweile viel in Berlin.
Es gibt für mich so einen Begriff, der über dir schwebt, und das ist das Thema Innovation.
Auch wenn es so ein bisschen so ein Bullshit-Bingo immer mal wieder ist, aber ich finde, das passt unglaublich gut zu dir.
Und darüber möchte ich heute auch mit dir reden.
Innovation, wahrscheinlich ganz viele Unternehmen wissen, dass sie da Geld, Zeit, Ressourcen reinschmeißen müssen, mit großem Würf.
Gleichzeitig sind natürlich ganz viele gerade damit beschäftigt, internationale und nationale Krisen zu überwinden.
Trotzdem muss das Thema Innovation vorangetrieben werden.
Wie erklärst du das jetzt zu einem kleinen Mittelständler, der sagt, ey, pass auf, ich krieg nicht mal meinen Stahl irgendwie gerade ran.
Wie soll ich mich mit Innovation auseinandersetzen?
Aus Veränderung entsteht eben die Innovation.
Innovation ist ja etwas, was meistens durch Langeweile, durch Druck von außen, durch Krisen eben entstehen, durch Knappheit, also Corona-Krise, oder Energiekrisen und so weiter.
Auf einmal wurden die Leute halt kreativ.
Da musste man eine Lösung finden, eine neue Lösung.
Und die hat sich dann, vielleicht verstehe ich dich nicht, aber das muss man halt verstehen, dass diese Krisen positiv sind.
Ich versuche, sehr viel Optimismus zu verbreiten und zu sagen, die Krisenlage ist unangebracht, sondern diese Unsicherheitsenergie ist immer ein schöner Begriff, die müssen wir klug nutzen.
Krise als Chance.
Ich glaube, Deutschland ist bei einem sehr besonderen Scheideweg.
Würde ich sagen.
Wir waren sehr lange, sehr innovativ, auf eine gewisse Art und Weise waren Sie sehr erfolgreich.
Haben die letzten Jahre das jetzt so ein bisschen gefühlt, aber ich glaube, es ist schon so, wir haben sehr oft auf die Kosten der guten alten Zeit, glaube ich, gelebt.
Und gerade dieser Innovationsmotor ist so im Stocken, würde ich sagen.
Und wenn wir dann, wir haben es schon kurz angesprochen, das Stadt-Land-Gefälle uns angucken, das sind auch noch mal spannende Energien, die vonstatten gehen.
Du arbeitest gerne und oft und sehr bewusst im Ländlichen, ne?
Du hast eine Pop-up-University gegründet.
Das fänd ich ganz cool, wenn du ein, zwei Sätze noch dazu sagen könntest.
Und dann meine eigentliche Frage ist, was du glaubst, wo es gerade auf dem Land oder in kleinstädtischen, wo ist da der Hak beim Thema Innovation?
Die Pop-up-Universität war letztes Jahr ein Experiment, wo ich einfach Studierende aus Potsdam in dem Fall eingepackt hab.
Wir sind mit dem Regionalexpress nach Ostpregnitz-Ruppin gefahren, nach Wittstock, und haben dort eine Woche mehr oder weniger die Universität aufgepoppt, der Borea.
Und haben dort mit der Stadtverwaltung als auch mit dem städtischen Gymnasium zusammengearbeitet.
Und das ist das Entscheidende, was ich glaube, zwischen diesem Stadt-Land-Gefälle, das sehr klar ist, Großstadt versus Land.
Wir haben ein paar mittelständische Unternehmen getroffen.
Die kriegen halt viele Dinge ehrlicherweise gar nicht mit.
Oder haben die halt in einer falschen Einordnung.
Oder selbst die Schüler vom städtischen Gymnasium, die kennen die Welt aus Social Media und aus Netflix, sagen wir mal so.
Ich war mit einer internationalen Studentengruppe da, mit 15 Nationalitäten und alles auf Englisch.
Wir haben uns da über die Zukunft des Codings unterhalten und wie bestimmte Technologien auf was Einfluss haben.
Also die große, weite Welt zusammengepackt und dann mal mitgebracht, um mal den Horizont zu öffnen.
Neue Perspektiven reinzubringen, auch so ein bisschen zu challengen.
Also schon zu challengen und zu sagen, aber was macht ihr eigentlich, macht das so alles noch Sinn?
Neue Horizonte idealerweise aufzumachen und zu sagen, Bastian, so haben wir das noch gar nicht gesehen.
Wenn ich das so schaffe, im Kopf dieses Reframing bei den Leuten, bei den Schülern, bei den Menschen zu schaffen, dann ist diese Reise in die Region dann immer schon viel wert.
Was, glaub ich, immer wieder so ein Schlagwort ist, auch grade aus Unternehmen, was man auch total nachvollziehen kann, ist dieses Thema Kapazitäten.
Was sagst du einem Unternehmer, Unternehmerin, die sagen, alles schön und gut, aber ich weiß nicht, wer oder wann ich's machen soll.
Dieser Innovationsdruck, der ist unterschiedlich groß.
Ja, wenn du natürlich in wettbewerbsintensiven Märkten bist und hast halt irgendwie Shareholder, die Druck machen, um da zu wachsen, aber jetzt mal im Mittelstand, da habt ihr einfach das Geschäft im Griff.
Natürlich bleibt's nicht aus, dass du ein paar Sachen digitalisieren musst und ein paar Dinge ausprobierst, aber das ist wirklich inkrementell, maximal inkrementell, da reden wir gar nicht von Innovationen, sondern du verbesserst dich an der einen oder anderen Stelle.
Echt, ja?
Es erstaunt mich, das hätte ich nicht gedacht, dass du da diese Klarheit sagst.
Immer mehr, immer mehr.
Warum eigentlich?
Weil die Welt hat so von, wie hat man mal gesagt, Software is eating the world, hat auch lange stattgefunden.
So, jetzt kommt KI, jetzt geht quasi der ganze ...
Früher hat man immer Angst gehabt, dass die Blue-Colors, also die Handwerker von Robotern, ersetzt werden und so weiter.
Jetzt hat KI gezeigt, dass die White-Colors, also die Leute mit dem Kopf arbeiten, die Adressierten sind, die unglaublich unter Druck stehen.
Da gibt's die neuesten Zahlen, die machen einen fast Angst.
Wenn du heute was mit der Hand machst, vom Friseur, Physiotherapeut, das Einzige, was du nur tun solltest, das wäre dann immer meine Frage, oder mein Rat ist immer, dass du dann versuchst, schon so ein bisschen digital befähigt, durch die Welt zu gehen.
Und nicht so sage, ich schreibe heute noch einen Fax oder so.
Also die Basics.
Die Basics, die digitalen Basics, die solltest du im Griff haben.
Von dir kommt auch dieser wunderbare Satz, dass es zu viele Lösungen gibt für zu wenig Probleme.
Was meinst du damit?
Ich glaube, das würden viele challengen.
Ja, genau.
Der wirkt erst mal, als wenn er so ein bisschen quer ist, der Satz.
Was meint der damit?
Grundsätzlich ist ja die Aussage, dass wir auf der Lösungsseite, also alles, was wir in Richtung Technologie und Angebot, alles, was es im Markt gibt an Lösungen, es gibt halt extrem viele Lösungen.
Technologielösungen, Softwarelösungen, KI-Lösungen, es gibt wirklich viele Sachen.
Gerade von Startups.
Startups sind sehr schnell, oh, das ist eine tolle Lösung, und knapp die Hälfte aller Startups scheitert, weil es keine Probleme, kein ausreichendes Problem, Market Need.
Ist das validiert?
Ja, es validiert.
Es gibt natürlich verschiedene Studien, aber das ist mal so eine breite Studie, die ist ein paar Jahre alt.
Aber die nehm ich immer recht gerne.
Ganz kurz für den deutschen Markt oder grundsätzlich?
Es ist ein Phänomen, das ist in Deutschland sogar noch krasser, weil wir noch mehr Technologieverliebtheit, noch mehr Ingenieurliebe haben zum Detail.
Das heißt, die Technologie scheitert.
Und warum?
Weil sie nicht ausreichend Probleme hat.
Es gibt wahnsinnig viele Lösungen, aber die Kunst ist, ein passendes Problem zu finden.
Da sollte man immer anfangen.
Klingt fast banal, in jedem Entrepreneurship-Unternehmer-Handbuch steht, du musst auf den Kunden, was hat der Kunde für Jobs to be done?
Jobs, die er halt erledigt haben will.
Darauf richtet man seine Lösung aus.
Aber es ist eben nicht so.
Wie oft sind wir technologieverliebt oder inspiriert, dann machen wir das.
Da sag ich immer, ja, wo?
Und dann ist diese Problemfindung, Probleme sind die neuen Assets.
Das sag ich allen mittelständischen Unternehmen immer wieder.
Ich saß letztens wieder mit einem zusammen, der hat mir was von Friedhofssoftware erzählt.
Ein altgedienter Softwarehersteller, Friedhofssoftware.
Dann hab ich mir den Markt der Friedhofssoftware angeguckt.
Friedhofsverwaltungssoftware.
Da dachte ich, es gibt ja so einen Wachstumsmarkt.
Friedhof ist Wachstumsmarkt, wenn man so will, städtische Hand.
Das ist mit Software aus den 90er-Jahren.
Da denkst du sofort so, wow, cool.
Was haben Friedhöfe für ein Problem?
Mit was für Problemen beschäftigen sie sich?
Und diese Nischen zu finden, diese Probleme, diese Problem-Owner zu finden, die sitzen dann oft im Mittelstand oder in dem Fall öffentlicher Hand.
Aber es gibt viele mittelständische Betriebe, die mich immer begeistern, wenn ich sage, so geile Probleme.
Das bringt mich zu meiner nächsten Frage ganz smart.
Und zwar, wo können denn Mittelständler deiner Meinung nach, Technologie, ich meine, mit Technologie, wenn wir anfangen, wir brauchen einen hochspezialisierten Roboter, das ist Investmentzeit ohne Ende.
Aber ich glaube, es geht ja auch gerade darum, dass Deutsch ein bisschen schneller wird.
Wir sind verhaftet in Bürokratie und so weiter.
Ich weiß, es ist nicht ganz einfach zu sagen.
Wenn wir uns diese Mittelstandskaste, über die wir gerade so reden, wenn man sagt, das sind die einfach greifbaren Technologien, CGPT ist wahrscheinlich so das Erste.
Oder Google, die KI, halt irgendeine der generativen KI.
Wenn man sagt, das sind so leicht greifbare Technologien, die du gerne empfiehlst, oder wo Mittelständler sich mal reindenken können.
Mein nächstes Beispiel, es gibt auch Chat-GPT für Excel.
Ja, also als Add-in quasi oder als Add-on in bestehende Excel-Lösungen.
Alleine damit kannst du wahrscheinlich in vielen Unternehmen diesen ganzen Excel-Woost mal versuchen zu automatisieren.
Also das Low-Hanging.
Auch wenn man jetzt mit der Microsoft-Welt Word, Excel, PowerPoint und so aufgewachsen ist.
Selbst Microsoft bietet viele, sag ich mal, Automatisierungstools an.
Copilot und so.
Ist ja alles mehr, weil die Systeme oft da sind.
Die kleinen Mittelständischen Betriebe, die haben so was nicht mal meistens.
Aber wenn wir etwas größer denken, dann haben die das meistens schon.
Da sind ganz viele Dinge einfach da.
Entscheidend ist für mich, immer so eine Sandkasten-Logik zu definieren und zu sagen, okay, machen wir das jetzt im Betrieb?
Also Operation am offenen Herzen.
Oder wir machen erst mal einen kleinen Sandkasten auf und dann nehmen wir erst mal irgendwie ein Projektbeispiel oder einen Datensatz oder irgendwas, was uns erst mal nicht wehtut.
Den packen wir erst mal in einen Sandkasten, packen drei Förmchen rein und dann packen wir noch drei Talente dazu, die vielleicht gar nicht unsere eigenen sind.
Weil das ist immer die spannende Frage, diese Sandkasten-Logik.
Da muss man ja immer mal haben, die Lust hat, zu spielen.
Du hast ja vorhin auch schon mal gefragt, wie machen die Leute das mit den Kapazitäten.
Dann nehmen wir halt Studierende und setzen halt so ein, ob das ein Tagesprojekt ist oder ein Woche-Projekt.
Und dann kriegen die halt einen Sandkasten in Form einer Projektaufgabe, einen Datensatz oder was auch immer.
Und dann lass doch die damit arbeiten.
Weil die jungen Talente, gerade wenn sie technologieaffin sind, nutzen ja ganz anders Technologie, als selbst ich mir das manchmal vorstellen kann.
Weil die viel näher dran sind, die sind geboren in der digitalen Zeit, et cetera.
Und dann wirkt man darauf hin und das ist überschaubar.
Das ist zeitlich überschaubar.
Entweder bau ich mir den Sandkasten selbst oder nutze bestehende Tools.
Das waren die beiden Sachen, die ich gesagt hab.
Also bestehende Tools, den Sandkasten, und dann aber auch den Sandkasten mit fremden Talenten.
Du denkst ja sehr frei, auch durch deine ...
Durch.
Durch deinen Weg, ne?
Du hast ja auch, du hast richtig Abitur erst nicht richtig gemacht.
Du hast ja das Lesen lieben gelernt und so, ne?
Du hast ja selber, ich glaube, so einen Weg eingeschlafen, der dir so diesen Horizont geöffnet hat.
Und ich frage mich halt so ...
Ich kenne so immer mal wieder mal Gespräche damit mit Unternehmen und Unternehmern.
Einige sind total fit und die lieben das, die sehen das als ihre Aufgabe als Unternehmer.
Aber andere eben auch nicht.
Kann man so was beibringen?
Kann man so was da den ...
Kann man so was einpflanzen in so ein Unternehmen?
Mh ...
Ich sag mal, in dem Mensch selber ist natürlich so Mindset-Change.
Oder so was meinst du ja, ne?
Je früher, umso besser.
Ist immer klar, ne?
Aber grundsätzlich glaub ich schon, dass man am Mindset schon ein bisschen rütteln kann.
Besonders am Toolset.
Mindset ist halt so Kopf und Hand.
Also beim Tuning kann man relativ viel machen.
Probier das doch mal so aus.
Denk doch mal, sag ich mal, mach doch mal den Gedankenansatz so und so in der Umsetzung, ne?
Aber ist der Optimismus jetzt da, die Älteren schwieriger zu verändern?
Also da bin ich schon schwierig.
Da glaub ich auch an viele Change-Maßnahmen eben nicht.
Da bin ich auch der Meinung, dass bestimmte Prozesse in Unternehmen, du kriegst halt nicht alle auf Innovation.
Wird das auch okay?
Da gibt's ja die 70-20-10-Regel, 70 Prozent sind Performance.
Also ganz normal, klassisch, Geschäft wie immer schon gemacht.
Ja, mach.
Mach.
Und 20 Prozent sind dann mehr oder weniger ...
Ja, sind offen für so was.
Und 10 Prozent sind halt die Innovators.
So mal als Daumenregel, ja?
Und das passt auch.
Dass man auch nicht versucht, jetzt alle müssen jetzt irgendwie verändert werden oder mehr offen und so, müssen sie gar nicht.
Dann wird's auch irre irgendwann.
Dann wird's auch irre und am Ende, darf man auch alles nicht vergessen, oft ist ja so, gerade im größeren oder im kleinen auch, das Kerngeschäft liefert halt das Geld.
Da wird das Geld verdient, da kommt der Ursprung her und so.
Also sollte man ja nie vernachlässigen, ja?
Sondern halt mit einer gewissen Prozentanzahl, ich mein, 30 Prozent klingt jetzt fast wenig, oder wenn es 10 Prozent innovativ sind, die meisten Unternehmen machen 100-Prozent-Kern.
Und da ist ja immer dieser Ansatz, der theoretische Ansatz aus den, glaub ich, 90er-Jahren, der sagt, wenn du als Unternehmen richtig gut bist in dem, was du tust, fällst du automatisch in eine Lethargie, wo du sagst, ja, du machst halt deinen Kern, läuft doch.
Wir haben jetzt ganz viel über Ansätze, über wie kriegt man's rein, was sind so die Probleme, über diese ganzen konnektiven Punkte, glaub ich, geredet.
Aber über einen Punkt haben wir noch nicht geredet, aber ich bin gespannt, ob's dir auch so geht, und diese Frage, die dir gestellt wird von Unternehmern, ich würde sie mir stellen.
Was kostet das Ganze alles, mit was für Budgets muss ich rechnen?
Ich hab kein Innovationsbudget.
Was mach ich denn jetzt?
Also, ich sag jetzt immer, meine erste Antwort ist natürlich immer, also, ihr habt die beste jemals entwickelte Technologie, die es heute auf dem Planeten gibt, kriegt ihr für 20 Euro ein Abo.
Ja, ob's jetzt JGPT ist oder Gemini, ist ja am Ende egal, aber die wissen ja alle, was ich meine.
Und in dieser Technologiedemokratisierung, in der wir leben, ist das irre.
Von daher ist die Ausrede hinfällig, zu sagen, ich hab kein Budget für Technologie, wenn man jetzt mal KI, digitale Technologie als Ansatz nimmt.
Das ist ja alles da, kannst du nutzen.
Das ist am Ende trotzdem Arbeit, also, Innovation bedeutet auch Arbeit, Blutschweiß und Tränen, das ist jetzt nicht so ganz schnell gemacht.
Aber die Umsetzungsgeschwindigkeit ist halt drastisch erhöht.
Also, man sagt jetzt immer, früher hat man mal, also, vor zehn Jahren, in den letzten zehn Jahren, hat man gesagt, Ideas are shit, Execution is a game.
Also, geht nicht um die Idee, geht nur um die Umsetzung.
Und heute wird man immer sagen, Execution is cheap, Ideas are everything.
Man muss ein bisschen drüber nachdenken, aber es stimmt.
Gerade bei der Umsetzung von Dingen, zumindest zum Teil, kommt drauf an, wenn du ein Hardwareprodukt baust, aber diese ganze Entwicklung, Design, Validierung, also, diese ganzen Schritte, die vorher Jahre teilweise gedauert haben, machen wir heute in der Vorlesung.
Ich betreibe jetzt, ja.
Aber da ist halt eine unglaubliche Fähigkeit entstanden für alle.
Das ist ja der Witz, für alle, deswegen Demokratisierung.
Jeder kann es, jeder sollte es tun.
Ja, und einfach anfangen und ausprobieren.
Und dann auch relativ schnell kommst du mit relativ wenig Dingen weit.
Letzte Woche war es ein Exit wieder von einer Personen-Company, nach einem halben Jahr erfolgreich verkauft, eine Firma im KI-Bereich natürlich, an einen großen Player für 80 Millionen, also, ein Solo-Founder, kein externes Geld drin und so weiter und so fort.
Ich sag mal, it's time to build.
Für mich, ich bin ja noch nicht so alt, aber ich bin ja schon ein paar Jahre im Geschäft, es gab selten so eine gute Zeit wie jetzt, Dinge zu tun.
Vielleicht müssen gar nicht alle innovativ sein.
Jeder sollte wissen, wo sein eigener Sandkasten steht.
Das Gespräch mit Sebastian Harlecker zeigt, wer Probleme erkennt, hat heute die besten Chancen, wirklich etwas zu bewegen.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert diesen Podcast, lasst eine Bewertung da und sagt gerne weiter, dass es uns gibt.
Bis zum nächsten Mal.